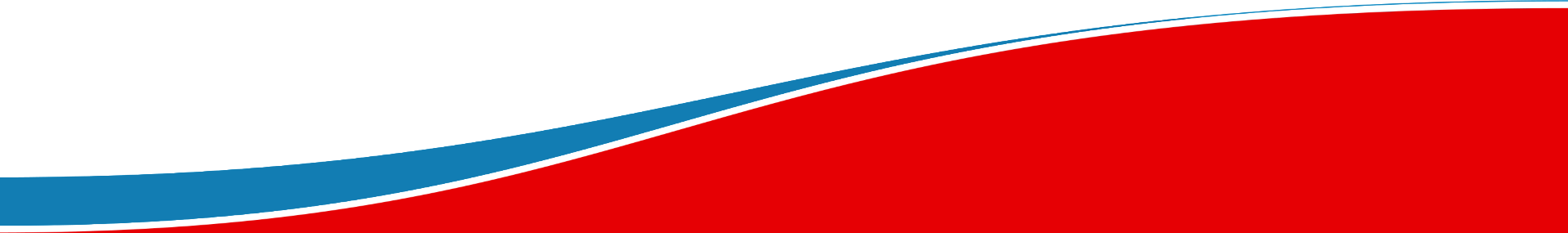Klimaschutz in Eislingen
Aktuelles:Die Energiekarawane, ein besonders Beratungsangebot der Energieagentur Landkreis Göppingen, kommt vom 4. bis 8. März 2024 nach Eislingen. Angeboten werden Beratungen bei Ihnen vor Ort oder auch im Eislinger Rathaus. Weitere Informationen finden Sie hier: |
Klimawandel
Der Klimawandel ist bereits spürbar und hat viele von Menschen beeinflussbare Ursachen. Um den Klimawandel zu begrenzen und seine Auswirkungen abzufedern sind wir alle gefordert, jede Bürgerin und jeder Bürger - von jung bis alt, die Unternehmen genauso wie die Kommunen und die Politik.
Unsere Verantwortung
Gerade die Kommunen üben dabei eine Vorbildwirkung aus. Die Stadt Eislingen ist sich ihrer Verantwortung bewusst und engagiert sich schon seit vielen Jahren, um die Auswirkungen des menschlichen Handelns auf das Klima zu verringern. So hat Eislingen bereits zahlreiche Klimaschutz- und Energieeinsparungsmaßnahmen erfolgreich umgesetzt.
Maßnahmen in der Mobilität
Im Bereich Mobilität waren dies unter anderem der Mobilitätspunkt am Bahnhof, Carsharing und Förderung der Elektromobilität. Auch die Erhöhung der Energieeffizienz und Energieeinsparungen im Betriebshof, die Erhöhung des Anteils an Elektrofahrzeugen und Dienstfahrrädern im städtischen Fuhrpark aber auch klimagerechte Bauleitplanung standen und stehen auf der Agenda.
Klimaneutral bis 2040
Die Stadt Eislingen setzt sich zum Ziel, bis zum Jahr 2040 eine weitgehend klimaneutrale Verwaltung zu erreichen. Deshalb hat die Stadt Eislingen/Fils Ende des Jahres 2021 die „Unterstützende Erklärung zum Klimaschutzpakt zwischen dem Land und den kommunalen Landesverbänden“ unterschrieben.
Der Weg zum Ziel
Ein wichtiger Schritt in diese Richtung stellt das Ausarbeiten eines Masterplans für die Nutzung der Dächer städtischer Liegenschaften durch Photovoltaik und Photothermie dar, der zeitnah umgesetzt werden wird. Dadurch wird nachhaltig die CO² Bilanz der städtischen Liegenschaften verbessert. Durch die Teilnahme am 'European Energy Award' bringt die Stadt Eislingen/Fils außerdem langfristig ihre lokale Energie- und Klimaschutzpolitik mit konkreten Maßnahmen beharrlich und erfolgreich voran.
Wie ist die Stadt aktiv
Der European Energy Award (eea) ist ein Zertifizierungs- und Qualitätsmanagementsystem, das es ermöglicht, den Energieeinsatz in Kommunen systematisch zu erfassen, zu bewerten und regelmäßig zu überprüfen sowie Potenziale zur Steigerung der Energieeffizienz zu identifizieren und dauerhaft zu nutzen. Weitere Informationen finden Sie hier.
Wie Sie das Klima schützen können
Ist es wirtschaftlich?
Welche Einnahmen könnte eine Solaranlage auf meinem Hausdach erzielen? Ist sie wirtschaftlich, oder ist mein Dach vielleicht gar nicht geeignet? In welcher Zeit würde sich eine solche Anlage, neu installiert, überhaupt amortisieren? Diese und weitere Fragen beantwortet das erweiterte Solarkataster der LUBW. Um die wirtschaftliche Nutzung des Daches besser abschätzen zu können, enthält das neue Solardachkataster einen Wirtschaftlichkeitsrechner, mit dem auch geplante oder bereits eingebaute Wärmepumpen, Batteriespeicher oder E-Autos berücksichtigt werden können. Die individuellen Berechnungen bekommen Sie übersichtlich in Grafiken und Tabellen präsentiert. Diese lassen sich auch abspeichern und können Grundlage für weiter Planungen sein.Solarkataster der LUBW
Hier können Sie die interaktive Karte aufrufen und nach der Eingabe Ihrer Adresse (Straßenbezeichnung Hausnummer, 73054 Eislingen/Fils) sofort prüfen, welche Solaranlage sich auf Ihrem Dach realisieren lässt:Solarkataster der LUWB
Energiesparen fängt zu Hause an!
Die Teilnahme am European Energy Award soll der Energieeinsparung dienen und dem Klimawandel entgegenwirken. Doch allein kommunale Maßnahmen, die meist von der öffentlichen Hand initiiert und umgesetzt werden, sind dafür nicht ausreichend. Jeder kann zu Hause etwas beitragen, beispielsweise durch einen geringeren Ressourcenverbrauch.Um dies zu erreichen, bietet die Energieagentur des Landkreises Göppingen eine neutrale Energieberatung für Bürgerinnen und Bürger des Landkreises an. Als Einstieg bietet die Energieagentur eine kostenlose und individuelle Erstberatung an. Neben der kostenlosen Erstberatung bietet die Energieagentur auch weiterführende Beratungen vor Ort an. Die Energieagentur des Landkreises Göppingen ist ein produktneutraler und anbieterunabhängiger Berater für die Bürgerschaft, Kommunen und Unternehmen in sämtlichen Energiefragen.
Sanieren für das Klima
Gebäude verursachen in Baden-Württemberg ein Drittel des Energieverbrauchs. Die Modernisierung und Sanierung auf den heutigen Stand der Technik birgt enorme Potenziale: Die so erzielte Energieeinsparung und die CO2-Emissionsreduktion können einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz leisten.- Hier geht es zur Webseite der "Zukunft Altbau".
Wie viel CO2 verbrauchen Sie?
Liegt Ihre persönliche CO2-Bilanz über oder unter dem stadtweiten Durchschnitt? Mit Hilfe des vom Umweltbundesamt unterstützten CO2-Rechners können Sie Ihre jährlichen CO2-Emissionen erfassen und herausfinden, in welchen Bereichen Sie bereits einen Beitrag zum Klimaschutz leisten und wo noch Potentiale verborgen sind.Der CO2-Rechner bildet fünf Bereiche des täglichen Lebens ab:
- Wohnen,
- Mobilität,
- Ernährung,
- persönlicher Konsum
- und der allgemeine Konsum.
Zum CO2-Rechner des Umweltbundesamtes
Weitere Informationen erhalten Sie hier.